Für Ihr erfolgreiches, gutes Leben Informationen, die Sie wirklich brauchen: Staatlich geförderter Verlag, ausgezeichnet mit dem Global Business Award als Publisher of the Year: Bücher, Magazine, eKurse, datengestützte KI-Services. Print- und Onlinepublikationen sowie neuste Technik gehen dabei Hand in Hand – mit über 20 Jahren Erfahrung, Partnern wie dem Bundesbildungsministerium, Kunden wie Samsung, DELL, Telekom oder Hochschulen. Dahinter steht Simone Janson, deutsche Top10 Bloggerin, referenziert in ARD, FAZ, ZEIT, WELT, Wikipedia.
Offenlegung & Urheberrechte: Bildmaterial erstellt im Rahmen einer kostenlosen Kooperation mit Shutterstock.
Suche nach Kontrolle: Können wir das Netz aus Angst beherrschen?
Von Simone Janson (Mehr) • Zuletzt aktualisiert am 27.02.2024 • Zuerst veröffentlicht am 19.12.2019 • Bisher 4389 Leser, 1475 Social-Media-Shares Likes & Reviews (5/5) • Kommentare lesen & schreiben
Viele Vorgänge im Internet sind für viele Menschen beängstigend. Denn der grundlegende Wandel, den diese neue Form von Kommunikation mit sich bringt, scheint vor allem eines: Unkontrollierbar. Dennoch wird es immer wieder versucht.

- Der Mythos Reputationsmanagement
- Streisand-Effekt: Angst vor dem Kontrollverlust
- Online-Reputationsmanagement
- Mensch vs. Technik
- Mitschwimmen statt kontrollieren!
- Privatsphäre bringt ohnehin nichts?
- Nackt bis auf die Haut: Wie viel erzähle ich von mir?
- Ist Privatsphäre tot?
- Post-Privacy-Spacken und Datenschutz
- Internet-Promis auf dem Rückzug
- Fast Food vs. Slow Food
- Datensicherheit auf der eigenen Seite: Dinge einfach wiederfinden
- Die Crux mit der Instant Befriedigung
- Das scheinbar bessere Verkaufen
- Idealismus vs. Realität
Der Mythos Reputationsmanagement
Dennoch versuchen gerade prominente Menschen immer wieder, das Internet kontrollieren, ja beherrschen zu wollen. Vielleicht sieht die Lösung ja ganz anders aus: Wir verzichten einfach ganz auf Kontrolle! Das ist gar nicht so absurd, wie es auf den ersten Blick klingt.
2003 verklagte die Sängerin und Schauspielerin Barbara Streisand den Fotografen Kenneth Adelman und die Website Pictopia.com auf 50 Millionen US-Dollar. Grund: Auf der Website war eine Luftaufnahme ihres Hauses zwischen 12.000 anderen Fotos von der Küste Kaliforniens zu finden war. Der Prozess entfachte das Interesse an dem Bild allerdings erst richtig und verbreitete es nicht nur tausendfach im Netz, sondern auch die Information, wer dort wohnt. Dieses Phänomen ist seitdem als Streisand-Effekt bekannt: Jemand verliert die Kontrolle, weil er sie mit Gewalt erzwingen will.
Streisand-Effekt: Angst vor dem Kontrollverlust
Psychologisch gesehen entsteht der Wunsch, das was im Internet über uns verbreitet wird, kontrollieren zu wollen, aus der Angst vor Fehlern, Kritik und negativen Folgen: Der Irrglaube, mit Maßnahmen wie ständigem Monitoring oder juristischen Mitteln negative Äußerungen über sich im Netz vermeiden zu können, ist leider weit verbreitet – unter Privatpersonen, aber noch stärker Unternehmen. Das wohl berühmteste Beispiel für einen gescheiterten Kontrollversuche ist Nestlé, das große Mengen Palmöl von einer indonesischen Firma bezog, die für ihre Plantagen großflächig Regenwälder vernichtet.
Damit macht sich Nestlé auch mitschuldig an der Ausrottung des Orang-Utans. Greenpeace nutze diverse Social Media Kanäle, u.a. YouTube und die Unternehmensseite von Nestlé aufmerksam zu machen. Was dann passierte, gilt als Paradebeispiel für den Streisand-Effekt: Statt sich der Kritik zu stellen und mit seinen Kunden in Dialog zu treten, machte Nestlé bei YouTube Copyright-Einwände geltend und schaffte es so auch für kurze Zeit, das Video aus dem Verkehr zu ziehen. In der Folge sperrte Nestlé auch noch seine Facebook-Seiten mit einigen hunderttausend Fans, auf denen Greenpeace ebenfalls aktiv gewesen war. Genau dadurch erregte die Geschichte aber genau die große Aufmerksamkeit im Internet und in den klassischen Medien, die Nestlé eigentlich hatte vermeiden wollen.
Online-Reputationsmanagement
Der Fachbegriff für den Versuch, die Meinungen im Netz zu steuern, heißt Online-Reputationsmanagement. Als sein Meister gilt der Münchener Kommunikations- und PR-Berater Klaus Eck, der regelmäßig zu diesem Thema schreibt. Nicht ganz zu unrecht hat Jeff Jarvis, der sich gerne und häufig vor allem über die Deutsche Angst vor dem Internet auslässt und selbst offen über seinen Prostata-Krebs bloggte, die Absurdität des Begriffs kritisiert: “Reputation ist in Euren Händen, nicht meinen” sagte er auf einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stifungund zeigt sich damit irritiert über die Auffassung, man könne sein Image im Netz managen.
Und die beiden Marketingprofessoren Detlev Zwick und Nikhilesh Dholakia haben festgestellt, dass technische Hilfsmittel, die den Datenschutz garantieren sollen, Kunden oft nur in der falschen Sicherheit wiegen, autonom zu handeln und daher mit Vorsicht zu behandeln seien. Denn auch wenn es richtig und wichtig ist, dass wir die Informationen, die online über uns zu finden sind, durch gezielte Herausgabe oder Vorenthalten von Informationen oder gegebenenfalls durch Sicherheits- und Freigabeeinstellungen in den verschiedenen Online-Diensten steuern können: Letztendlich sind weder Privatpersonen noch Unternehmen auch mit einer noch so ausgeklügelten Social Media Strategie nicht in der Lage, zu beeinflussen, was andere aus den Informationen machen, die sie erhalten.
Mensch vs. Technik
Dennoch verlassen sich viele Unternehmen allzusehr auf technische Tools – nicht nur beim Datenschutz, sondern auch beim Auswerten der Daten, dem sogenannten Monitoring. Wie die Studie “Smart Service im Social Web” von Tanya Dimitrova, Reiner Kolm und Bernhard Steimel zeigt, eignen die sich zwar hervorragend, um unverfälschte Kundenkritik im Netz zu finden und daraus Verbesserungspotenzial abzuleiten.
Der Schwachpunkt beim Monitoring liegt jedoch in der Auswahl des Datenmaterials: Denn viele Posts werden mehrfach gezählt, da in einem Beitrag mehrere Keywords vorkommen. Auch bei der semantischen Zuordnung gibt es Unschärfe, die die gesamten Zahlengerüste signifikant beeinflussen. Ferner enthalten Kundenäußerungen in Social Media zwar Meinungen, aber letztendlich wenig Informationen. Was aber noch schwerer wiegt: In der Regel meldet sich nur die Spitze des Eisbergs, meist eine kleine Gruppe unzufriedener, zu Wort. Daher können Unternehmen kein ganzheitliches Meinungsbild über Kunden und Potenzial aus Scoial Media ableiten, da ihnen die Informationen über die große schweigende Mehrheit fehlen. Und auch die genau Zielgruppe können sie so gar nicht wirklich einschätzen. Dass Monitoring-Tools und auch Online-Reputationsmanagement gerade von vielen Unternehmen als die Möglichkeit wahrgenommen wird, ihre Kundenwirkung in Social Media im Vorhinein abschätzen zu wollen, grenzt geradezu an Orakelei – und ist letztendlich ein folgenschwerer Denkfehler.
Mitschwimmen statt kontrollieren!
Denn statt intuitiv in Social Media mitzuschwimmen und als Teil einer unkontrollierbaren Dynamik unternehmerisch zu handeln, versuchen viele Unternehmen ihre Kontroll-Strukturen auf Social Media zu übertragen. Auf diese Weise ist ihr gesamtes Handeln von vorneherein nicht auf die Möglichkeiten der neuen Kommunikationsformen ausgerichtet, sondern primär auf Risikovermeidung. In perfektionischem Starrsinn achten sie dann peinlich-genau darauf, keine Fehler zu machen – übersehen dabei aber die vielen Chancen, die Social Media ihnen bietet. Zum Beispiel mit ihren Kunden in einen echten Dialog zu treten und auf deren Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Im Gegenteil, für große wie kleinere Unternehmen ist Social Media oft nur ein weiterer, preiswerter Marketing-Kanal, in dem sie sich schöner und besser darstellen, als sie wirklich sind. Authentizität, Ecken und Kanten und die Bereitschaft aus Fehlern und Erfahrungen zu lernen? Fehlanzeige! Dabei ist es genau dies Menschlichkeit und damit die Bereitschaft, auch zu seinen Fehlern zu stehen, die den Nutzen und Erfolg von Social Media ausmacht.
Wie das geht, zeigte Udo Vetter, durch seinen Blog bekannter Fachanwalt für Strafrecht, im Dezember 2010 auf dem Twittwoch in Düsseldorf. Dort wurde er nämlich u.a. gefragt, was sein peinlichstes Twitter-Erlebnis gewesen sei. Und erzählte eine Geschichte, bei der ich persönlich auch erstmal rote Ohren bekam: Vetter wollte Unterhosen kaufen und beschwerte sich via Twitter über die kratzigen Diebstahlsicherungen. Aber jedenfalls passierte Vetter das, was wahrscheinlich vielen Nutzern passiert: Er war sich nicht klar, wer da so alle mitliest. Denn einige Wochen später wurde er bei einer Verhandlung am Landgericht von einem der Beisitzer darauf angesprochen, ob es denn neuerdings normal sei, dass Anwälte öffentlich im Netz über ihre Unterhosen twitterten. Und Vetter war das, wie er beim Twittwoch zugab, doch ein wenig unangenehm. Aber es zeigte sich, dass der Beisitzer Humor hatte und auch über die Sache lachen konnte – vermutlich auch deshalb, weil Vetter eben nicht versuchte, seine Peinlichkeit zu negieren oder kleinzureden, sondern einfach dazu stand. Und die Geschichte heute locker und amüsant als Anekdote erzählen kann.
Privatsphäre bringt ohnehin nichts?
Geht man nach dem Blogger Michael Seemann, so bringt das ständige Achtgeben auf die eigenen Daten ohnehin nichts. Denn jeder und alles ist im Internet zu finden, selbst diejenigen, die bewusst versuchen, sich herauszuhalten und deshalb offline sind oder so wenig wie möglich über sich preisgeben. Denn auch wenn man selbst nicht aktiv ist, schreiben oder reden andere über einen oder stellen – noch schlimmer – Videos und Fotos online. Man muss sich nur anschauen, wie viel in einschlägigen Foren oder Social Media-Plattformen über bestimmte Unternehmen gelästert wird – selbst wenn diese gar nicht mitdiskutieren. Und diese Informationen verbreiten sich mit unglaublicher Schnelligkeit, weil sich dank Internet die Transaktionskosten für Information enorm gesenkt haben – ein Effekt, der sich in Zukunft noch potenzieren wird. Ja schlimmer noch: Der einzelne Datensatz liegt eben nicht mehr tot an seinem Speicherplatz, sondern wird durch immer neue Verknüpfungsmethoden mit anderen Daten verbunden, so dass Datenverknüpfungen entstehen, die unsere bisherigen Vorstellungen übertreffen.
Dagegen vorzugehen, ist laut Seemann unmöglich – wer es dennoch versucht, dem wird es ergehen wir Barbara Streisand. Seemann, im Netz besser bekannt als mspro, beschäftigt sich auf seinem Blog und in verschiedenen Publikationen mit diesem Kontrollverlust beschäftigt und glaubt, dass man diesen nicht nur hinnehmen, sondern auch als Chance begreifen kann. Denn in einer Welt, in der Offenheit und Transparenz für alle gelten, muss sich eben keiner mehr für sein Privatleben schämen. Daher spricht sich Seeman für eine radikale Umkehr in unserem Verhältnis zu Daten: Weg von der ständigen Kontrolle durch den Sender hin zu einer Filtersouveränität durch den Empfänger. So schreibt er:
“Gleichzeitig befreien diese unvorhersehbaren, weil unendlichen Querys auch den Sender der Information. Sie befreien ihn davon, Erwartungen entsprechen zu müssen. Denn der Andere kann, weil er in unendlichen Quellen mit perfekt konfigurierbaren Werkzeugen hantiert, keinen Anspruch mehr an den Autor stellen – weder einen moralisch-normativen noch einen thematisch-informationellen. Die Freiheit des Anderen, zu lesen oder nicht zu lesen, was er will, ist die Freiheit des Senders, zu sein, wie er will.”
Nackt bis auf die Haut: Wie viel erzähle ich von mir?
Die großen Fragen unsere Zeit sind also, und zwar für Unternehmen wie Privatpersonen, gleichermaßen: Größtmögliche Authentizität oder größtmögliche Kontrolle? Und wenn Kontrolle, wie kann man sie überhaupt behalten? Welche Daten sollte man preisgeben – und welche nicht? Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest gibt seit 1998 jährlich die JIM-Studie heraus. JIM steht dabei für “Jugend, Information, (Multi-)Media” und genau darum geht es: Untersucht wird der Umgang von 12- bis 19-Jährigen mit Medien und Information. Der Schwerpunkt Studie liegt dabei auf Internet-Nutzung und Mobiler Kommunikation und sie förderte erstaunliches zu Tage: Die von Erwachsenen im Bezug auf das Internet gerne als besonders schutzbedürftig angesehenen Jugendlichen wissen offenbar relativ genau, welche Informationen sie in sozialen Netzwerken freigeben können – und welche nicht.
Beispielsweise haben drei Viertel der jugendlichen Internet-Nutzer Informationen über Hobbies oder andere Aktivitäten im Netz hinterlegt. 64 Prozent haben Fotos oder Bewegtbilder von sich selbst eingestellt, vier von zehn Internet-Nutzern zeigen entsprechendes Material, auf dem Freunde oder Mitglieder der Familie dargestellt sind. 37 Prozent haben ihre eMail-Adresse hinterlegt ein Viertel präsentiert die Daten, mit denen sie per Instant-Messenger erreichbar sind. Und nur vier Prozent nennen Ihre Handy- oder Telefonnummer. Mit dem Hype der Online-Communities verzeichnete die Studie auch einen deutlichen Anstieg der im Internet hinterlegten Daten. Mittlerweile hat sich die Lage allerdings auch wieder “normalisiert” – sicherlich auch, weil die Nutzung von Sozialen Netzwerken als Kommunikationsschwerpunkt insgesamt ein wenig zurückgegangen ist. Deutlich mehr Jugendliche achten mittlerweile darauf, wie sie mit Datenschutz-Einstellungen in Sozialen Netztwerken ihre Informationen nur ausgewählten Mitmenschen freigeben; Und das, wo diese Privacy-Einstellungen in der Regel schwer zu finden sind. Mädchen (72 Prozent), Volljährige (71 Prozent) und Gymnasiasten (73 Prozent) nutzen die Privacy-Option dabei überdurchschnittlich.
Ist Privatsphäre tot?
Daten über sich freizugeben, muss aber nicht nur negativ sein: Julia Schramm, ehamaliges Mitglied der Piratenpartei, erklärte in einem Interview mit Spiegel Online den Datenschutz für tot: “Privatsphäre ist sowas von Eighties… Der Aufwand, private Daten zu kontrollieren und zurückzuhalten, ist mittlerweile unverhältnismäßig hoch. Im Endeffekt können wir uns nicht dagegen wehren… Also Flucht nach vorne… Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich im Gegenzug auch viel zurückbekomme, neue Freundschaften, Anregungen, Unterstützung.” Ähnlich sieht das auch der Berliner Kommunikationsberater Thomas Praus: “Wenn ich bei Foursquare sage, wo ich bin, hoffe ich auf Begegnungen mit denen, die mir dort folgen. Wenn ich auf Twitter mit jemandem diskutiere, hoffe ich, dass alle, die dort zuhören, etwas von der Unterhaltung haben. Wenn ich erfahre, dass ein Freund auch gerade in Kolumbien ist und ich den dann nach Jahren treffen kann: Finde ich das fantastisch. Diese ganze Öffentlichkeit um meine Aktivitäten im Netz haben mir schon so viel Ideen, Feedback, spontane Treffen, Verbindungen gebracht, dass es absolut ABSURD ist, Angst zu haben.”
Wie Michael Seemann sich statt Datenschutzeinstellungen seine Filtersouveränität vorstellt, hat er zur Einführung von Google+ in seinem Blog erklärt: Dort organisieren die Nutzer ihre Freunde in Circles. Informationen, die sie nun bei Google+ posten, können sie dann für einen oder mehrere Circles lesbar machen oder gleich für alle öffentlich freigeben. Seemann aber plädiert für den umgekehrten Weg: Nicht der Absender der Posts sollte einteilen, wem er was freigibt, sondern die Leser sollten die Wahl haben, die Informationen aus den Circlen wie in Chanels zu abonnieren. Daraus, so folgert Seemann in seinem Blog, ergibt sich eine ganz neue, freiwillige Privatssphäre: “Und so hat auch jeder Mensch diverse Rollen. Diese Rollen werden aber auch im realen Leben nicht aktiv und restriktiv durchgesetzt, sondern sie werden uns vom Anderen gewährt, ja sogar von ihm verlangt. Es wird erwartet, diese Rollen zu spielen und zwar im vollen Bewusstsein darüber, dass wir – die selbe Person – in anderen Kontexten völlig andere Rollen ausfüllen. In Wirklichkeit will mein Chef nämlich gar nicht wissen, dass ich mich in Clubs daneben benehme. Er will nur nicht, dass ich es gegenüber Kunden tue. Ich bin davon Überzeugt, dass ich mein Privatleben nicht vor meinen Chef verstecken muss. Er will es gar nicht wissen. Wenn er die Möglichkeit hat, mein Privatleben zu ignorieren, wird er es tun.”
Post-Privacy-Spacken und Datenschutz
Julia Schramm und Michael Seemann gehörten, gemeinsam mit Christian Heller, zu den bekanntesten Protagonisten einer Bewegung, die sich selbst als datenschutzkritische Spackeria bezeichnete. Den Namen haben sich die Mitglieder selbst gegeben, nachdem Konstanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Club (CCC) im Rückblick auf den 27. Kommunikationskongress des CCC im Dezember 2010 die Vertreter der Post-Privacy-Bewegung als Post-Privacy-Spackos bezeichnet hatte. Die selbsternannten Spacken werteten den zunehmenden Verlust der Privatsphäre im Netz, eben die besagte Post-Privacy, nicht als Problem sondern als Chance und bloggten unter regelmäßig darüber.
Ihre Kritiker, u.a. die Digitale Gesellschaft um Markus Beckedahl, die sich u.a. für eine Verbesserung von Datenschutz-Gesetzen stark machen, warfen der Spackeria unverantwortliche Verallgemeinerung vor. Wer seine Daten offen ins Netz stellen wolle, könne das ja tun, sagte zum Beispiel Constanze Kurz auf einem re:publica-Vortrag – aber das solle doch bitte nicht zur Maxime für alle erhoben werden. Und natürlich darf nicht übersehen werden, dass von einer vollständigen Transparenz von Konsumenten und Bürgern eben auch für den Staat und Wirtschaft profitieren: Erstere, weil sie so besser überwachen, letztere weil sie ihre potenziellen Kunden so noch besser manipulieren können. Schon heute gibt es erste Versuche mit Werbetafeln, die Benutzer erkennen und personenbezogene Werbung anzeigen können. Abhilfe können nach Markus Beckedahl, der nicht nur Deutschlands erfolgreichstes Blog “netzpolitik.org” betreibt und in der Enquete-KommissionInternet und digitale Gesellschaft des Bundestages sitzt, Privacy Enhancing Tools schaffen: “Das sind Anonymisierungswerkzeuge, Verschlüsselungswerkzeuge und eben auch Einstellungen in den Social Networks, die standardmäßig auf ‘Alles verbergen’ geschaltet sind. So dass Du bewusst erst einmal alles freischalten musst – statt umgekehrt. In solche Technologien müssen wir weiter investieren, das muss der Marktstandard werden. Dabei kommt Deutschland eine internationale Vorreiterrolle zu. Und es ist vorstellbar, dass wir, ähnlich wie grüne Produkte, bald datenschutzfreundliche Produkte in alle Welt exportieren.”
Internet-Promis auf dem Rückzug
Längst sind es übrigens nicht mehr nur die Social-Media-Gegner, die das Netz mit einer gewissen Skepsis betrachten. Auch Menschen, die eigentlich wissen sollten, wie das geht mit diesem Internet, weil sie langjährige Erfahung mit der Technik und dem Web haben, ziehen sich mittlerweile daraus zurück. Sascha Lobo, dessen Followeranzahl von mehr als 70.000 nur durch Dieter Nuhr übertroffen wird und der auch sonst keine Gelegenheit ausließ, ein Loblied auf Twitter zu singen, twittert längst nicht mehr mehrmals am Tag, ja noch nichtmal mehr jeden Tag. Auch sein Blog schläft vor sich hin. Robert Basic, einer der führenden deutschen Blogger, schrieb einst über Twitter: “Mehr oder minder verkommt Twitter zur reinen Infomaschinerie, blutet sozial aus. Das schärft das Produkt, gleichzeitig wirkt es zunehmend steriler. Keine Untersuchung, keine Studie, reiner Eindruck, der sich seit Wochen und Monaten verstärkt.”Netzaktivist Linus Neuman, Autor bei Deutschlands derzeit meistgelesenem Blog Netzpolitik.org twittert: “Habe in letzter Zeit immer weniger Lust auf Internet.” Johnny Häusler, der Vater von Spreeblick, ebenfalls ein sehr bekanntes Deutsches Blog, schrieb über Entscheidungs- und Konzentrationsschwächen, Ideenverlust, Gedächtnislücken und bekannte ironisch: “Das Internet hat mein Leben zerstört.” Und während jeder selbsternannte Selbstvermarktungsexpert darüber schwadronniert, wie wichtig Leserkommentare sind, schaffte Kai Müller, Betreiber des bekannten Blogs Stylespion mit mehr als 15.000 Abonennten, sie einfach ab: “Ich rede mich nicht lange raus. Schon seit längerem erkenne ich in den Kommentaren hier wenig Sinn. Deshalb ist die Kommentarfunktion nun deaktiviert.”
Kürzlich verriet mir einer der bekannteren deutschen Blogger die Beweggründe für seinen Rückzug. Nennen darf ich ihn namentlich nicht, da er in Web und Medien weniger präsent sein möchte. Und zwar aus solchen Gründen: Er wurde auf dem Flughafen von einem Menschen angesprochen, der ihn begrüßte wie einen alten Freund, sich nach seinem Befinden erkundigte und ihn überhaupt gut zu kennen schien. Das Problem war nur: Der Blogger hatte keine Ahnung, wer ihn da so freudig begrüßte. Und fand das Erlebnis reichlich beängstigend. Koketterie von Berühmtheiten des Netzes oder echte Überforderung? Vielleicht beides! Vielleicht auch ab einem gewissen Bekanntheitsgrad völlig normal – man denke nur daran, wie Stars mit Paparazzi umgehen, von denen sie in einer Art symbiotischer Hass-Liebe abhängig sind.
Fast Food vs. Slow Food
Manchmal scheitern wir jedoch mit unserem Wunsch nach Kontrolle auch schlicht an der menschlichen Bequemlichkeit – oder um es anders auszudrücken: Dem Wunsch nacht Zeitersparnis. Die meisten Leute würden vermutlich zustimmen, dass Zeitersparnis zwar etwas Positives ist, Fast Food aber langfristig eher schädlich für Figur und Gesundheit ist. Nicht umsonst gibt es mittlerweile eine Slow-Food-Bewegung und Bio-Essen auch beim Discounter. Was das jetzt mit Social Media zu tun hat? Nun, da ist es nicht viel anders: Viele nehmen im Vorbeigehen mal hier und da einen Happen von Facebook mit oder naschen bei Twitter, es soll ja schließlich schnell und bequem gehen. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht satt und trotzdem fett werden. Denn wie in den meisten anderen Dingen auch, so gilt auch für Social Media: Gut Ding will Weile haben. Kürzlich erklärte mir der PR Chef eines eher traditionell orientierten Unternehmens, dass man ja auch in Social Media aktiv sei. Das hieß in dem Falle: Eine Facebook-Seite mit rund 40 Fans, auf der kaum Interaktion stattfand. Dass es genau der Marketingstrategie von Facebook entspricht, es seinen Nutzern einfach zu machen, habe ich ja schon erwähnt. Und das spiegelt genau die Denke wieder, der viele anhaften: Social Media heißt in der Regel Facebook und Twitter, das sind ja auch weltweit die erfolgreichsten Kanäle. Dass es auch andere wichtige Plattformen wie Blogs, YouTube oder Flickr gibt, wissen die meisten; doch die Einstiegshürden erscheinen den meisten als zu hoch. Denn ein gut laufendes Blog lässt sich nun mal leider nicht im Vorbeigehen hochziehen. Natürlich gibt es auch da Anbieter bei denen man gratis ein vorgefertigtes Layout bekommt und dann einfach loslegen kann (Text schreiben muss man natürlich immer noch, aber das ist ja überall so). Doch wie immer, wenn es schnell gehen soll: Das Ergebnis ist dann doch nie so wie man es haben will. Und aus jahrelanger Erfahrung kann ich sagen, dass ein gutes, benutzerfreundliches Design außerordentlich wichtig für den Erfolg ist. Denn nicht nur gewinnt man damit einen gewissen Wiedererkennungswert, sondern man kann die Leute auch viel besser auf die wichtigen Dinge Aufmerksam machen. Denn erfahrungsgemäß nehmen Leser nur das war, was sich vor ihrer Nase befindet. Dahin muss man Ihnen die Dinge, von denen man möchte, dass sie unbedingt gelesen werden, direkt vor die Augen halten wie dem Hasen die berühmte Karotte. Zum Beispiel indem man die Startsite eines Blogs entsprechend gestaltet. Genau das wäre für mich ein Grund, niemals Fast-Blogging-Tools zu benutzen und noch weniger würde ich meine eigene Seite zugunsten von Facebook aufgeben: Sie haben dort einfach zu wenig Einstellungsmöglichkeiten.
Datensicherheit auf der eigenen Seite: Dinge einfach wiederfinden
Der andere wichtige Grund für ein Blog ist sind für mich Datenschutz und Datensicherheit. Zu oft habe ich den letzten Jahren erlebt, dass Plattformen zumachten und man seine liebe Not hatte, all die liebgewonnen Texte zu retten. Das hat darüber hinaus noch den Vorteil, dass man die Sachen auch nach Jahren noch wiederfindet. Zum Beispiel durch die Suchmaschinen. Denn überlegen Sie mal: Wenn Sie irgendetwas suchen, werfen Sie vermutlich zuallererst google an. Und wie oft finden Sie dann Einträge von Facebook-Pages oder Profilen? Doch eher selten. Blogs hingegen tauchen ziemlich oft ziemlich weit vorne in den Suchergebnissen auf. Ich wurde auf diese Weise zum schon zu Beiträgen interviewt, die ich vor Jahren geschrieben hatte – man hatte mich einfach gegoogelt. Und mehr noch: Auch man selbst kann auf diese Weise alte Beiträge, Kommentare, Diskussionen wiederfinden – um so mehr, wenn man beim Bloggen auf eine übersichtliche Struktur achtet und die Beiträge vernünftig taggt. Stellen Sie sich vor, sie haben vor Jahren mal einen Spannenden Artikel irgendwo gelesen und sich dazu ein paar Gedanken gemacht. Wenn Sie das bei Twitter oder Facebook gefunden haben, haben Sie kaum Chancen, den Artikel wiederzufinden, denn Sie sind längst im Nirvana verschwunden. Im Blog hingegen genügen je nach Ordnung nur ein paar Klicks oder eine gute Suchfunktion. Für mich ist mein Blog daher nicht nur ein Kommunikationstool, sondern auch mein persönliches Themenarchiv, in dem ich Themen und Ansprechpartner sammle, auf die ich hinterher wieder zurückgreifen kann. Davon abgesehen, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass irgendwer die Fotos und Informationen, die ich auf meinem eigenen Server ablege, zu Werbezwecken weiterverkauft. Bloggen ist also sicherer und spart, nach anfänglichem Aufwand, sogar Zeit. Mit einem Wort: Es ist nachhaltiger. Nur mit der Einsicht harpert es bei vielen Leuten noch: Kürzlich erklärte mir jemand, dass ja auch Printmedien Zeitungsarchive hätten, in denen man alte Artikel auch wieder finden kann. Dass nur wenige Menschen in Zeiten des Internets diesen Aufwand auf sich nehmen, um Informationen zu finden – daran hat mein Gesprächspartner im Moment wohl nicht gedacht. Google geht eben doch schneller!
Die Crux mit der Instant Befriedigung
Und trotzdem erleben wir zunehmend, dass Menschen aus Bequemlichkeit auf ihr eigenes Medium verzichten. Das bekommen eben auch Webdesigner zu spüren- Vor einiger Zeit versuchte ich an einer deutschen Hochschule Studenten die Vorteile eines eigenen Blogs nahe zu bringen. Thema meines Vortrags war: Jobsuche und Networking im Internet. Und diesmal waren nicht angehende Journalisten die Zuhörer, sondern Wirtschaftswissenschaftler. Die Begeisterung ließ, gelinde gesagt, zu wünschen übrig. Zu Facebook könne man sich gerade noch durchringen. Aber zum Bloggen, so der Einwand, fehle einfach die Zeit. Und daran, dass potenzielle Arbeitgeber durch eine eigene Webpräsenz im Netz auf Jobsuchende aufmerksam werden könnten, glaubte sowieso keiner. Mal abgesehen davon dass ich die Haltung “Bringt ja nichts, also lasse ich es lieber!” in jeder Beziehung für ziemlich dämlich halte, muss man sich fragen: Warum verbringen so viele Leute Stunde um Stunde bei Facebook und Twitter, aber halten es für zu aufwändig, ein eigenes Blog, also etwas wirklich Sinnvolles zu starten? Warum also geben so viele Privatleute wie auch Unternehmen Twitter und Facebook den Vorzug und verzichten trotz aller Vorteile auf ein eigenes Blog? An der reinen Zeitersparnis kann es ja nicht liegen, denn wie wir bereits gesehen haben, kann man auch durch Soziale Netzwerke auch sehr viel unnötige Zeit verlieren. Der wahre Grund dürfte ein anderer sein, wie Robert Basic so treffend anlysiert hat. Und Basic weiß, wovon er redet. Er bloggt selbst seit 2003 und zwar auch kommerziell erfolgreich: 2009 verkaufte er sein erfolgreiches Blog basicthinking.de, zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 der deutschen Blogcharts, für 46.902 Euro meistbietend bei Ebay. Nach seiner Auffassung versprechen gerade Twitter und Facebook eine instant gratification, eine Art sofortiger Belohnung oder Befriedigung: “Das Betreiben einer Facebook-Seite und eines Twitter-Accounts führt recht schnell zu vermeintlichen Erfolgserlebnissen. Im Gegensatz zu einem Blog und den kaum fassbaren Lesern bekommt man auf Facebook und Twitter ein anderes Gefühl vermittelt: Die Liker und Follower sind greifbarer, fühlen sich echter an… Es ist wenig erstaunlich, dass Unternehmen gerne mit ihren Follower/Like-Zahlen hausieren gehen. Sie können es intern besser verkaufen als anonyme Blog-Leser, die man nicht zu fassen bekommt.”
Das scheinbar bessere Verkaufen
Besser verkaufen – genau das ist gerade für viele Unternehmen der Knackpunkt: Vor allem bei Facebook mit seinen gut 750 Millionen Mitgliedern weltweit scheint es für Unternehmen attraktiv, vertreten zu sein. Denn man will ja schließlich da sein wo die Kunden sind. Und wer möchte nicht die Chance haben, derart viele potenzielle Kunden zu erreichen? Zumal es einem Facebook mit Like-Buttons oder Twitter mit dem Follw-Button auch wirklich einfach machen, Kunden, Follower und Anhänger zu sammeln. Was dabei wirklich herauskommt, wieviele Menschen dann wirklich an einer Person oder einem Unternehmen Interesse haben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Schön also, wenn ein Unternehmen Schwanzvergleichen behaupten kann, 10.000 Fans bei Facebook zu haben – oder Follower bei Twitter. Der Anteil derer, die sich darunter wirklich mit dem Unternehmen beschäftigen und zu denen man eine langfristige Beziehung aufbauen kann, dürfte in Wirklichkeit viel geringer sein. Man denke nur an das Beispiel FHM. Sich eine Instant Befriedigung zu verschaffen, in dem man den schnellen, einfachen Weg wählt, mag vielleicht kurzfristig einige positive Ergebnisse bringen. Nachhaltigen Erfolg reicht man so aber nicht. Das hat in den 1960er und 1970er Jahren der Psychologe Walter Mischel eindrucksvoll demonstriert. In der Vorschule der Stanford Universität bekamen Vierjährige eine Aufgabe: Man bot ihnen einen Marshmallow an, denn sie sofort essen könnten. Aber wenn Sie einige Minuten warten und sich gedulden würden, würden sie noch einen weiteren bekommen. Die Reaktionen waren höchst unterschiedlich: Einige Kinder aßen den Marshmallow gleich. Andere mussten sich ablenken oder die Augen verschließen, damit sie sich beherrschen konnten. 14 Jahre später stellte Mischel fest: Die Kinder, die damals sofort zugegriffen hatten, waren auch als Erwachsene eher alsstur, ungeduldig und neidisch. Die, die sich damals beherrschen konnten, waren hingegen stressresistent, sozial kompetent und zuverlässiger. Kurzum: Sie waren auch im Leben erfolgreicher. Die populäre News-Site Mashable.com, eine der bekanntesten Anlaufstellen für Technik- und Internetthemen, hat sich die Mühe gemacht, auszuwerten, wie viele ihrer 2,2 Millionen Follower bei Twitter und der rund 460.000 Fans bei Facebook wirklich auch auf der Seite vobeigucken. Das Ergbnis zeigt: Nur ein kleiner Teil der Fans und Follower klickt überhaupt wirklich auf die Site. Und: Der Erfolg ist bei Twitter und Facebook sehr unterschiedlich.
Idealismus vs. Realität
Noch einmal zurück zur Frage: Post-Privacy oder Datenschutz? Die Wahrheit zwischen diesen polemisch streitenden Gruppen liegt wahrscheinlich, wie so oft, in der Mitte. Oder wie Marina Weißband, vormals politische Geschäftsführerin der Piratenpartei, es treffend auf den Punkt bringt: “Post-Privacy sagt: ‘Ein Mensch muss die Daten freigeben können, die er will.’ Datenschutz sagt: ‘Ein Mensch muss nur die Daten freigeben können, die er will.’”
Einerseits haben die Post-Privacy-Propheten sicherlich recht, wenn sie davon sprechen, dass es immer schwieriger wird, die eigenen Daten im Internet zu kontrollieren. Und vermutlich werden die gewaltigen Veränderungen, die das Internet mit sich bringt, sicherlich mittelfristig zu einem gesellschaftlichen Umdenken führen (müssen). Das zeigt schon alleine das heutige Datenschutzrecht, das auf Vorstellungen aus den 70′er und 80′er Jahren fußt, wie Thomas Stadler so passend ausführt: “Die derzeitige Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass das Datenschutzrecht nicht fit für das Internetzeitalter ist und viele real existierenden Dienste, die von Millionen Bürgern und Unternehmen genutzt werden, nicht datenschutzkonform sind. Jedenfalls nicht, wenn man das Verständnis der berufsmäßigen Datenschützer zugrunde legt. Das führt zur Entstehung von Post-Privacy-Bewegungen, die weit über das Ziel hinaus schießen, aber letztlich zu Recht den derzeitigen Zustand beklagen. Wir können uns also weiterhin etwas vormachen oder endlich eine offene Bestandsaufnahme durchführen.”
Andererseits ist ihre Hoffnung auf eine transparentere, offenere Gesellschaft doch recht idealistisch gedacht. Und es stellt sich die Frage, ob Resignation, nach dem Motto “Wir können das eh nicht kontrollieren, also lassen wir es” tatsächlich der richtige Weg sind und ob es sich nicht doch lohnt, sich für einen stärkeren Schutz der einzelnen Daten einzusetzten – wie die folgenden Beispiele zeigen.
Hier schreibt für Sie
 Simone Janson ist Verlegerin, Beraterin und eine der 10 wichtigsten deutschen Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index. Sie ist außerdem Leiterin des Instituts Berufebilder Yourweb, mit dem sie Geld für nachhaltige Projekte stiftet. Laut ZEIT gehört ihr als Marke eingetragenes Blog Best of HR – Berufebilder.de® zu den wichtigsten Blogs für Karriere, Berufs- und Arbeitswelt. Mehr zu ihr im Werdegang. Alle Texte von Simone Janson.
Simone Janson ist Verlegerin, Beraterin und eine der 10 wichtigsten deutschen Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index. Sie ist außerdem Leiterin des Instituts Berufebilder Yourweb, mit dem sie Geld für nachhaltige Projekte stiftet. Laut ZEIT gehört ihr als Marke eingetragenes Blog Best of HR – Berufebilder.de® zu den wichtigsten Blogs für Karriere, Berufs- und Arbeitswelt. Mehr zu ihr im Werdegang. Alle Texte von Simone Janson.


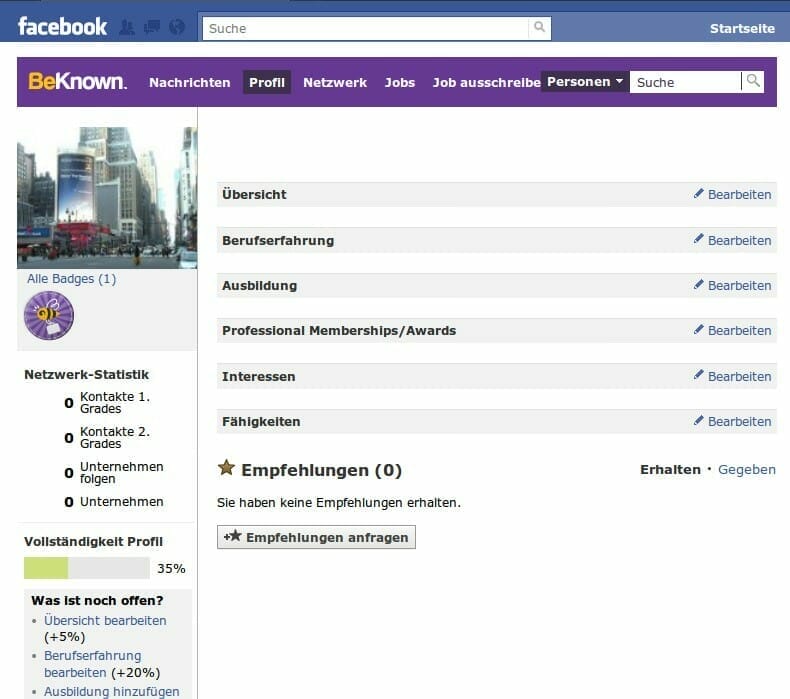






Schreiben Sie einen Kommentar