Für Ihr erfolgreiches, gutes Leben Informationen, die Sie wirklich brauchen: Staatlich geförderter Verlag, ausgezeichnet mit dem Global Business Award als Publisher of the Year: Bücher, Magazine, eKurse, datengestützte KI-Services. Print- und Onlinepublikationen sowie neuste Technik gehen dabei Hand in Hand – mit über 20 Jahren Erfahrung, Partnern wie dem Bundesbildungsministerium, Kunden wie Samsung, DELL, Telekom oder Hochschulen. Dahinter steht Simone Janson, deutsche Top10 Bloggerin, referenziert in ARD, FAZ, ZEIT, WELT, Wikipedia.
Offenlegung & Urheberrechte: Bildmaterial erstellt im Rahmen einer kostenlosen Kooperation mit Shutterstock.
Authentisch in Social Media: Gemeinsam Einsam?
Von Simone Janson (Mehr) • Zuletzt aktualisiert am 09.02.2024 • Zuerst veröffentlicht am 17.12.2019 • Bisher 5769 Leser, 1643 Social-Media-Shares Likes & Reviews (5/5) • Kommentare lesen & schreiben
Viele Menschen sind einsam. Das Internet, so wird suggeriert, kann helfen Einsamkeit zu überwinden. Doch es hat mittlerweile ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und auch sonst bietet das Thema so seine Tücken.

- Wie glaubwürdig sind Nutzer?
- Gemeinsam einsam?
- Kommunikation im öffentlichen Zwischenraum
- Realitätsverlust durch das Internet als große Gefahr?
- Kotzende Einhörner beim Flittern
- Im Internet kommunizieren – aber richtig!
- Wechselwirkung zwischen Online und Offline
- Der Trick mit dem Gruppenzwang: Was alle machen, will ich auch!
- Der Mitmacheffekt: Als Vegetarier allein auf der Barbecue-Party
- Sinn und Unsinn Sozialer Netzwerke: Sklaven des Mitmacheffekts?
- Checkliste: Gruppenzwang und unerwünschte Einladungen bei Facebook vermeiden
- Sozialer Druck und Gruppenzwang
- Social Media aus Angst vor Vereinsamung?
- Die Stärke schwacher Bindungen
- Marktplatz im globalen Dorf
- Märkte sind Gespräche
- Licht und Schatten der Kommunikation
Wie glaubwürdig sind Nutzer?
Man darf in sozialen Netzwerken nicht alles so bierernst nehmen, weil die Dinge hier oft einfach nur zugespitzt werden. Das ist Teil des Spiels. Doch auch wenn man das weiß, ist es nicht immer einfach dieses Spiel zu durchschauen. Und es besteht immer die Gefahr, dass man sich von anderen ein falsches Bild macht.
Amina Abdallah Araf al Omari war 2011 die Vorzeigebloggerin aus dem durch das Regime unterdrückte Syrien: Die lesbische junge Frau berichtete direkt von den Unruhen in ihrer Heimat. Bis sie von syrischen Polizeikräften abgeholt wurde und verschwande, wie in ihrem Blog zu lesen war. Aber all das stimmte gar nicht. In Wirklichkeit hatte ein 40-jähriger verheirateter weißer Amerikaner, der im schottischen Edinborough studierte, sich als Amina ausgegeben. Er wollte mit dem Fake-Blog die Dissidenten in Syrien unterstützen. Am Ende verriet ihn die IP seiner eMail-Adresse. Unabhängig davon, dass er mit diesem Betrug die echten syrischen Quellen nur noch unglaubwürdiger machte, zeigt die Geschichte vor allem eines: Wie leicht es ist, im Internet, zumindest für eine Zeit, seine Identität zu fälschen. Nun ist das Internet nicht voll von gefakten Identitäten. Die meisten Menschen agieren, wie schon festgestellt, vergleichsweise Deckungsgleich mit ihrer reelen Persönlichkeit – auch wenn manche von ihnen ein Pseudonym benutzen.
Gemeinsam einsam?
Der Soziologe Simon Edwin Dittrich hat sich für einen Sammelband der Heinrich Böll Stiftung zum Thema “#public_life – Digitale Intimität, die Privatsphäre und das Netz ” ausgiebig damit beschäftigt, wie sich das veränderte Kommunikationsverhalten auf den Einzelnen und die Gesellschaft auswirkt. Nach seiner Beobachtung führen die modernen Technologien vor allem zu einer Zunahme der asynchronen Kommunikation. Damit sind Unterhaltungen gemeint, bei denen die Gesprächspartner entweder nicht zeitgleich oder nicht am selben Ort agieren.
Als Beispiel nennt Dittrich das Schreiben von SMS beim Essen. Auf Seite 100 des #public_life-Bandes erzählt er: “Als ich Kind war, wäre es undenkbar gewesen, vom Abendbrottisch aufzustehen, um ans Telefon zu gehen. Wenn ich heute mit Freunden gemeinsam esse, kommt es öfters vor, dass mehrere von uns in ihr Telefon schauen, Emails checken, SMS schreiben, Twittern oder auf Facebook schreiben. Natürlich hagelt es auch immer wieder Kritik von Menschen, die es als unhöflich empfinden, wenn man ihnen nicht seine volle Aufmerksamkeit widmet. Aber die Vehemenz nimmt ab. ” Für Dittrich ist das nicht nur ein singuläres Phänomen, sondern hat Auswirkungen auf unsere Gesellschaft: Beispielsweise unterhalten sich viele Reisende in Zügen nicht mehr miteinander, sondern via Handy oder Laptop mit anderen, weit entfernten Gesprächspartnern. Statt also mit dem direkten Umfeld zu kommunizieren, spricht man zunehmend nur selektiv mit Menschen, die man sich selbst ausgesucht hat. Das aber macht die Wahrnehmung selektiver und Austausch ärmer: Viele Informationen, die man in einem Gespräch unter Reisenden zufällig bekommen würde, bleiben dabei auf der Strecke. Bildhaft ausgedrückt: Der Tunnelblick auf die mobile Kommunikation kann so verhindern, dass sich der eigene Horizont erweitert.
Kommunikation im öffentlichen Zwischenraum
Für Dittrich entsteht auf diese Weise ein öffentlicher Zwischenraum, in dem paradoxerweise aber vor allem private Handlungen vollzogen werden – beispielsweise wenn sich Leute im Bus via Mobiltelefon streiten und das alle mitbekommen. Und genau aus diesen Zwischenräumen ist es hinterher auch schwieriger, wieder herauszukommen, wie Dittrich konstatiert, denn sie sind eben nicht wirklich privat: “Mit den Spuren, die wir in den öffentlichen Zwischen(t)räumen zurück- lassen, wird es aber schwieriger, ein Umfeld komplett zu verändern. Jedenfalls ist es nicht so ‘einfach’ wie aus Klein-Gummersbach nach Hamburg zu ziehen, denn unsere Online-Profile bleiben unverändert.” Eine Erfahrung, die auch Vivian Pein machte. Die 29-Jährige war Community-Managerin bei Xing und wurde auch als solche im Netz wahrgenommen. Dazu hatte sie mit ihren zahlreichen Aktivitäten im und um das Netz auch selbst beigetragen. Dann aber wechselte sie zum Logistikunternehmen Hermes als Social Media Managerin. Das Problem: Viele ihrer Online-Kontakte haben den Jobwechsel gar nicht mitbekommen – und sprechen sie immer noch als Xing-Mitarbeiterin an.
Noch einen Schritt weiter geht die amerikanische Psychoanalytikerin und Soziologie-Professorin Sherry Turkle. Sie erforscht seit über 30 Jahren die Auswirkungen moderner technischen Entwicklung auf unser Leben. In ihrem neuen Buch “Alone Together” warnt Sie vor der schleichenden Vereinsamung, die kommunikativen Veränderungen mit sich bringen können. Denn das Internet, vor allem in der mobilen Version für Hand– oder Hosentasche, böte jederzeit die Möglichkeit, den komplexen zwischenmenschlichen Beziehungen der Realität zu entfliehen – so wie die Studentin, die ohne weiteres ihren Freund gegen einen Roboter als Liebhaber eintauschen würde, um sich die Welt einfacher und besser zu machen. Oder wie Kollegen, die eMails oder SMS ins Nachbarbüro schicken, weil es ihnen zu intim vorkäme, dort einfach vorbeizuschauen. Wichtige Informationen und gefühlsmäßige Regungen, die in einem Telefonat oder im persönlichen Gespräch mitausgetauscht würden, fehlten dabei – und genau dadurch verändere sich nicht nur die Kommunikation sondern die zwischenmenschlichen Beziehungen insgesamt. So sagt Turkle in einem Interview: “Man kann online andere Beziehungen haben. In einer gewissen Weise enthüllen die Menschen mehr von sich selbst. Aber sie enthüllen das, was sie enthüllen wollen, nicht unbedingt das, was der andere wissen will! In einer Freundschaft von Angesicht zu Angesicht findet eher ein echter Austausch statt. Ich untersuche solche Chats seit den frühen neunziger Jahren, und wissen Sie was: Wenn es ungemütlich wird, dann kneifen die Leute. Es gibt viel weniger Verbindlichkeit in den Beziehungen.”
Realitätsverlust durch das Internet als große Gefahr?
Nun mag Turkle recht haben damit, dass im Internet soziale Beziehungen, anders, nämlich oberflächlicher ablaufen und das damit für manche Menschen eine Gefahr des Realitätsverlustes einhergeht, wenn man sich zu sehr darauf einlässt. Die Medizinerin Shima Sum von der Universität Sidney zeigte zudem 2008 in einer Studie unter Senioren, dass sich schon bestehende Einsamkeit nur sehr schlecht mit Social Media, Chats, Foren und privaten Nachrichten bekämpfen. Im Gegenteil, wenn sich erst die Isolation im realen Leben den Weg ins virtuelle sozialeNetz bahnt, wird der Mangel an echten Freunden eher noch größer. Allerdings darf man Online-Intimität eben nicht mit echter Intimität verwechseln. Und natürlich sind Textnachrichten im Internet bequemer als Telefonate oder das persönliche Gespräch, weil man eben mit einer großen Zahl von Menschen in Kontakt stehen und diese gleichzeitig mehr auf Distanz halten kann, als das zum Beispiel bei einem Telefonat möglich wäre, bei dem wir persönlich anwesend sein müssen und die Stimme – und die darin mitschwingenden Emotionen – des anderen hören. Allerdings kann ich nicht erkennen, was daran verkehrt sein soll, im Gegenteil, um effizient arbeiten zu können, ist diese Filterung sogar unablässig. Zumal Turkle auch über sich selbst sagt, dass eMails auch ihr wichtigster Kommunikationsweg sind. Eine holländische Studie von Patti M. Valkenburg und Jochen Peter zeigt folgerichtig auch das Soziale Medien ein hervorragendes Mittel sind, um einen bereits bestehenden Bekanntenkreis zu pflegen.
Man muss also differenzieren. Einmal nach den Gründen, wie warum man soziale Medien nutzt, aber auch danach, mit wem man kommuniziert und warum. Denn natürlich besteht die Gefahr, dass man seinem inneren Schweinehund nachgibt und faul zu Hause sitzen bleibt, statt sich persönlich mit Menschen zu treffen. Und während die meisten Menschen im richtigen Leben oft sehr genau wissen, wer Freund, Kollege, guter Bekannter oder Feind ist, scheint genau diese Unterscheidung viele Menschen in Sozialen Netzwerken zu verwirren. Das merke ich immer dann, wenn mich Leute, die sich normalerweise ja auch nicht mit jedem auf ein Bier verabreden, unsicher fragen “Was mache ich denn, wenn ich bei Facebook eine Freundschaftsanfrage von jemandem bekomme, den ich nicht als Freund haben will?” Grund dafür ist, dass die Kommunikation in digitalen Zwischenräumen zwar öffentlich, aber doch oft auch irgendwie persönlich ist. Die strikte Trennung zwischen Öffentlich und Privat existiert im Netz also nicht mehr, die Grenzen sind aufgehoben. Die Frage ist daher: Wie gehen wir damit um? Brauchen wir neue Grenzen? Oder sind wir grenzenlos frei?
Kotzende Einhörner beim Flittern
Daniel Decker sitzt auf der großen Bühne im Friedrichstadtpalast und trinkt Wodka. Und er redet übers Flittern. Flittern, das ist Flirten via Twitter, wo Decker als @kotzend_einhorn aktiv ist. Und er stellt ernüchtert fest, dass zwischen der Kommunikation bei Twitter und dem Realen Leben eben doch große Unterschiede bestehen: Twitter, so seine Erfahrung, ist eben nicht die Chance für Schüchterne, den Lebenspartner zu finden.
So geschehen in der Veranstaltung “What’s happening? Love.”, die zu einem der großen Publikumsmagneten auf der Blogger-Konferenz re:publica 2011 avancierte. Wohl auch deshalb, weil das ein Thema ist, bei dem jeder irgendwie mitreden kann. Wirklich spannend aber war die Diskussion zwischen Decker und Moderatorin Teresa Bücker über Rollenspiele und Kommunikationsverhalten bei Twitter, die bis heute als Video bei Youtube zu sehen ist. Während Bücker die Ansicht vertrat, dass Menschen, die bei Twitter sehr klug, nett und eloquent seien, das meist auch in der Realität seien, hatte Decker andere Erfahrungen gemacht: Der bekennende Telefonmuffel kann sich schriftlich viel besser ausdrücken als mündlich und musste sich daher nach erfolgreicher Kontaktanbahnung im Netz anhören: “Auf Twitter bist Du viel Lustiger… irgendwie bist eine ganz andere Person.” Seine Erklärung dafür: “Selbst wenn man im Netz unter seinem realen Namen agiert und sich möglichst wenig versteckt, ist es natürlich immer noch so, dass man natürlich ein Figur kreiert. Das kann natürlich auch im realen Leben passieren. Aber der Unterschied ist, dass man sich bei Twitter vor dem ersten Treffen schon viel intimer und viel weiter ausgetauscht hat, als wenn man sich so auf einer Party trifft. Deswegen ist das Bild, das sich das Gegenüber schon gemacht hat, ein ganz anderes.”
Im Internet kommunizieren – aber richtig!
Genau das ist der wichtige Punkt: Menschen machen sich nunmal ein Bild von anderen, wenn sie mit ihnen reden. Das setzt sich daraus zusammen, was jemand sagt – aber unbewusst auch aus den Gesten, der Mimik und dem Tonfall der Stimme. Genau diese Merkmale fehlen bei der Kommunikation in sozialen Netzwerken. Zum Beispiel auch, weil man in Sozialen Medien in der Regel schriftlich kommuniziert. Dadurch fehlen uns aber dann wichtige Informationen, die uns unsere Gesprächspartner im persönlichen Dialog durch die Stimme, Gestik und Mimik unbewusst mitteilen. Der amerikanische Psychologe Albert Mehrabian fand 1967 in zwei Studien heraus, dass die Wirkung einer Botschaft nur zu sieben Prozent vom Inhalt des Gesagten abhängt. 55 Prozent werden durch Körpersprache bestimmt und 38 Prozent durch Stimme, Tonfall, Betonung und Artikulation. Was aber tun, wenn uns diese 93 Prozent der Kommunikation fehlen – zum Beispiel, wenn wir mit Leuten eben nur twittern oder bei Facebook chatten, statt mit ihnen persönlich zu reden? Dann müssen wir uns diese Informationen dazu denken und neigen vielleicht dazu, ob wir wollen oder nicht, uns ein Bild zu machen, mit der Realität nichts oder wenig zu tun – je nachdem, wie gut wir unseren Gesprächspartner wirklich kennen.
Daher sollten soziale Netzwerke immer nur Teil unserer Kommunikation sein – die persönliche Kommunikation sollten sie aber nicht ersetzten. Wenn das doch geschieht, besteht die Gefahr, dass wir uns von unseren Gesprächspartnern, sei das nun von ihnen beabsichtigt oder nicht, ein völlig falsches Bild machen. Wie sehr sich das Bild, dass die Menschen von sich im Netz abgeben, vom realen Menschen unterscheidet, hängt allerdings offenbar stark von der persönlichen Zufriedenheit ab. Die Medienpsychologen Sabine Trepte und Leonard Reinecke von der Hamburg Media School haben in mehreren Studie die Auswahl von Avataren bei Computerspielen untersucht. Die Daten belegen, dass die meisten Menschen ihre Avatare in Spielszenarien mit männlichem Anforderungsprofil vorwiegend mit positiven maskulinen Eigenschaften, etwa Größe und Stärke, ausstatten. In Spielszenarien mit weiblichem Anforderungsprofil überwiegen hingegen positive weibliche Eigenschaften. Allerdings bevorzugten die Probanden in der Regel gleichgeschlechtliche Avatare. Und: Je zufriedener ein Mensch mit sich selbst ist, desto mehr ähnelt ihm sein Avatar. Wer dagegen seinem Leben eher unglücklich war, der malte sich seine virtuelle Welt um so schöner – und um so eher unterschied sich sein Avatar von der eigenen Person.
Wechselwirkung zwischen Online und Offline
Umgekehrt wirken erstaunlicherweise aber auch Avatare und Online-Verhalten auf die eigene Persönlichkeit: So fanden Trepte und Reinecke auch heraus, dass Menschen, die in Sozialen Netzwerken vieles über sich verraten, bereits nach sechs Monaten auch im realen Leben offener und mitteilsamer sind und auch mehr Freunde haben. In eine ähnliche Richtung gehen auch die Ergebnisse des Honkong-Chinesen Nick Yee: Im Rahmen seiner Dissertation an der Stanford Universität belegte er, dass Menschen, die ein besonders gut aussehendes und damit beim anderen Geschlecht erfolgreicheres Alter Ego im Netz hatten, irgendwann auch im realen Leben offener mit ihrem Privatleben umgingen und auch schneller zu sexuellen Kontakten neigten. Offenbar hatte sie der Online-Erfolg mutiger gegenüber anderen Menschen gemacht.
Diese Beispiele zeigen vor allem auch eines: Dass Menschen ihre Identität nicht nur aus sich selbst heraus definieren, sondern vor allem auch im Umgang mit anderen. Oder anders Ausgedrückt: Aus den Reaktionen der Außenwelt auf das eigene Tun und Handeln formt jeder Mensch ein Bild von sich selbst. Was aber passiert, wenn sich die Kommunikation mit anderen Menschen so frapierend ändert, wie das im Moment durch Social Media und mobile Kommunikation der Fall ist?
Der Trick mit dem Gruppenzwang: Was alle machen, will ich auch!
Die Künstlerin Carola Rümper hatte lange keinen Bock auf Facebook: Ständig die ganzen Geschichten über Daten, die weitergegeben werden, alles ist öffentlich und jeder bekommt mit was man macht – Nein Danke! Dabei hatte die Bildende Künstlerin aus Berlin das Internet längst für sich entdeckt: Auf spezialisierten Kunst-Portalen wie Kulturserver.de und artists.de ist sie seit Jahren unterwegs, um Informationen zu finden, sich mit anderen auszutauschen und ihre Arbeit zu vermarkten. Aber Facbook? Das war ihr einfach zu undifferenziert.
Dann kam der 21.01.2011. Das war der Tag, an dem Rümperer sich nach langem Zögern dann doch bei Facebook registrierte. Weil, gerade in der Berliner Kunstszene, irgendwie alle da waren. Weil sie ihre Arbeit vermarkten wollte. Und weil sie das Gefühl hatte, etwas zu verpassen, wenn sie nicht auch dabei ist. Mittlerweile nutzt sie Facebook etwa zwei oder dreimal in der Woche. In der Regel um zu sehen was Andere machen, welche Ausstellungen es so gibt wurden und um selber Werbung für ihr eigenes Atelier zu veröffentlichen. Ihre Skepsis allerdings ist geblieben.
Der Mitmacheffekt: Als Vegetarier allein auf der Barbecue-Party
So wie Carola Rümperer geht es vielen Menschen, die bislang noch nicht beigetreten sind: Sie hören ständig von Sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Schließlich ist das Thema dauerpräsent – sei es in den Medien, bei Freunden, Kollegen oder Bekannten. Wenn ALLE mittags in der Kantine darüber reden, was aus dem Nachbarbüro bei Facebook gepostet wurde oder man die entsetzte Frage verneinen muss: “Wie, Du hast noch kein Account?”, hinterlässt das das ein ungutes Gefühl. Nämlich der einzige zu sein, der keine Ahnung hat – ganz so als ob man als Vegetarierer alleine auf einer Barbecue-Party ist oder ein bunt-karriertes Kleid trägt, über das alle tuscheln. Wer will schon derjenige sein, der draußen steht und die Party verpasst?
Sinn und Unsinn Sozialer Netzwerke: Sklaven des Mitmacheffekts?
Diesen Mitmacheffekt nutzen viele Unternehmen, um neue Kunden zu gewinnen – man denke nur an die Partnertarife bei Handys, die darauf abzielen, seine Freunde ebenfalls von den Qualitäten des Anbieter X oder Y zu überzeugen. Und auch Soziale Netzwerke, die ja ebenfalls gewinnstrebende Unternehmen sind, machen genau das: Sie spannen all jene vor ihren Karren, die bereits dabei sind, um neue Mitglieder zu werben. Aus unternehmerischer Sicht übrigens durchaus sinnvoll: Schließlich besteht das Geschäftsmodell darin, möglichst viele Benutzer zu gewinnen. Wie sinnvoll und sozial das den Kunden gegenüber ist, darüber lässt sich streiten. Gerade bei Facebook!
Facebook geht nämlich besonders aggressiv vor, wenn darum geht, noch mehr Menschen von seinen Qualitäten zu “überzeugen” – vermutlich ein Grund, warum es innerhalb weniger Jahre zum beliebtesten Online-Netzwerk weltweit avancierte. Das Webanalyse-Unternehmen Pingdomhat Google Trends ausgewerte und 29 Soziale Netzwerke aufgelistet, die weltweit mehr als eine Million Zugriffe täglich für sich verbuchen können. Mit 310 Millionen täglichen Seitenzugriffen liegt Facebook mit weitem Abstand ganz vorne. Mit 51 bzw. 37 Millionen Zugriffen weit dahinter liegen die in Deutschland weitgehend unbekannten Netzwerke Orkut und Qzone. Erst dann folgt Twitter mit 22 Millionen täglicher Zugriffe.
Der Schlüssel zu diesem unglaublichen Erfolg für Facebook heißt eMail-Freunde-Finder. Damit können registrierte Mitglieder alte Bekannte und Freunde wiederfinden, indem sie dem Netzwerk Zugriff auf ihr eMail-Konto gewähren. Dadurch findet Facebook nicht nur heraus, wem Sie jemals von diesem eMail-Account geschrieben hat, nein, praktischerweise können Sie auch noch all diejenigen gleich zu Facebook einladen, die noch nicht registriert sind. Schnell, schön und einfach. Das “aber” folgt auf dem Fuß: Auch wenn Facebook versichert, Ihr Passwort nicht zu speichern: Zumindest die importierten eMail-Adressen werden dabei von Facebook gespeichert und weiterhin genutzt! Und so bekommen dann auch all die ahnungslosen Menschen in Ihrem eMail-Adressbuch, die bisher mit Facebook nichts zu tun haben wollten, Post von dem “blauen Riesen” mit der freundlichen, aber doch quengeligen Frage, ob sie nicht doch endlich mal beitreten wollen.
Checkliste: Gruppenzwang und unerwünschte Einladungen bei Facebook vermeiden
- Ignorieren Sie alle Aufforderungen von Facebook, Freunde in anderen Netzwerken oder aus Ihrem eMail-Adressbuch zu finden.
- Geben Sie auf keinen Fall ihr eMail Passwort oder das Passwort aus anderen Netzwerken bei Facebook ein – selbst wenn da steht, dass es nicht gespeichert wird.
- Falls Sie Freunde suchen, die bereits auf Facebook sind: Dazu gibt es oben im Blauen Balken ein Suchfeld.
- Es ist schon passiert und Sie haben doch schon eine Adressbuch-Synchronisation durchgeführt? Dann können Sie die importierten eMail-Adressen löschen.
- Und wenn Sie selbst das Opfer sind, weil jemand anders Ihre eMail-Adresse oder IM-Namen importiert? Dann klicken Sie in der Mail, die Facebook geschickt hat auf den Link “Keine Mails mehr von Facebook erhalten”. Ihre Daten können Sie dann über aus der Facebook-Datenbank entfernen.
Sozialer Druck und Gruppenzwang
Als Google im Juni 2011 sein eigenes und mittlerweile wieder geschlossenes Netwerk Google + (sprich Google Plus) startete, setzte es zunächst auf eine komplett andere Strategie als Facebook: In einem Feldversuch mit sehr eingeschränktem Nutzerkreis, die dem Netzwerk nur mit speziellen Einladungen beitreten durften. Diese Strategie des limitierten Zugangs wendet zum Beispiel auch die Firma Apple bei ihren Produkten an – und sie funktioniert hervorragend: Denn Nutzer, die das neue Produkt oder eben das neue Netzwerk so schnell wie möglich ausprobieren wollen, werden nur um so neugieriger, je mehr man ihnen vorenthält, was sie wollen. So schrieb der Podcaster und Programmierer Max Winde am 30.06.2011 bei Twitter: “Ärgere mich darüber, dass ich mich darüber ärgere, dass ich noch keinen Google Plus Account habe.”Natürlich funktioniert das vor allem bei neuen Produkten, langfristig will Google natürlich genau das Gegenteil erreichen: Nämlich möglichst viele Nutzer von Facebook überzeugen, doch zu Google zu wechseln.
Die Methode ist eine ganz andere als bei Facebook, der Effekt ist der gleiche: Auf diese Weise wird sozialer Druck ausgeübt. Dass das aus Sicht der Unternehmen so gut funktioniert, liegt daran, wie unsere Psyche gestrickt ist: Dass Menschen soziale, auf Gemeinschaft ausgelegte Wesen sind, wusste schon der griechische Philosoph Platon. Dementsprechend lassen sie sich bei Ihren Entscheidungen stark von ihrem Umfeld beeinflussen – bis hin zum sozialen Druck, dem wir schließlich nachgeben. Wie zahlreiche psychologische Experimentezeigen, ist der Einfluss unserer Freunde teilweise so stark, dass Menschen sich auf sozialen Druck hin selbst gegen ihr Gewissen entscheiden.
Im Hinblick auf Soziale Netzwerke ist Gruppenzwang sicherlich nur ein Motiv, ihnen beizutreten – es gibt ja auch viele Vorteile wie den schnellen Informationsaustausch oder praktische Finden alter und neuer Bekannter: Doch durch den sozialen Druck und die Angst vor Vereinsamung wird ein wenig verständlicher, warum viele, selbst hartgesottene Gegner, dann plötzlich doch Mitglied in einem Sozialen Netzwerk werden. In meinem Bekanntenkreis gibt es einige, die zunächst im Brustton tiefster Überzeugung behaupteten: “Da findest Du mich nie!” Und eines Tages überraschten sie mich dann doch bei Facebook mit einer Freundschaftsanfrage.
Aber ungeachtet der vielen Vorteile: Die Ängste und Vorbehalte sind bei vielen Nutzern immer noch da. Und sie fragen sich: Was passiert mit meinen Daten? Wer liest da eigentlich mit? Und was können die Leute damit anfangen? Falsch ist es auf keinen Fall, sich Gedanken um Datenschutz und verantwortungsvolles Verhalten im Internet zu machen. Allerdings muss man sich mit dem Thema vernünftig auseinandersetzten, Erfahrungen sammeln und so eine eigene Meinung bilden. Sich sozialen Netzwerken zu verschließen und in lautes Weheklagen auszubrechen, führt zu Nichts. Genau das ist in Deutschland das Problem.
Die Stärke schwacher Bindungen
Oft höre ich die Kritk, man doch ebenso gut eMails schreiben könnte wie soziale Netzwerke nutzen. Oder telefonieren – zum Beispiel auch per Skype. Eben nicht: Der Pinnwandeintrag bei Facebook, die Statusmeldung bei Xing oder ein Tweet schaffen neue Möglichkeiten der Kommunikation – ganz so, als ob sich auf einem Marktplatz zwei Leute unterhalten und ein dritter zufällig hinzukommt. Hätte man sich vorher verabredet, hätte man vielleicht Terminschwierigkeiten gehabt. Übrigens wird dabei, wie auf einem echten Marktplatz, nicht nur geplaudert, es werden auch wichtige Informationen ausgetauscht, es wird verhandelt und verkauft.
Entscheidend aber ist: Durch dieses Kommunikationsmittel entsteht erst ein Dialog, den es sonst gar nicht gäbe. Man denke nur daran, wie oft man eine eMail nicht schreibt, weil es doch so zeitraubend ist. Oder die Antwort ewig vor sich herschiebt, weil man einfach keine Zeit findet, mal eine richtig schöne eMail zu schreiben. Oder man ruft eben Leute nicht an, weil man selbst gerade keine Zeit zum Quatschen hat oder den anderen nicht bei der Arbeit stören will und kann. In sozialen Netzwerken, egal ob sie nun Facebook, Twitter oder Diaspora heißen, funktioniert der Dialog hingegen, weil die Leute sich mal eben zwischendurch Nachrichten und kurze Informationsfetzen zukommen lassen können, ohne dass man darum ein großes Aufheben macht. Das klappt, weil man keine langen Einleitungen schreiben muss, was man in den vergangenen Monaten so getrieben hat, sondern wenige Zeilen genügen, um seine Zielperson mit einem Update zu versehen. Gerade weil die Nachrichtenlänge nur auf 140 Zeichen beschränkt ist, ist zum Beispiel Twitter so erfolgreich, dass sich auch andere Service-Anbieter das Prinzip abgeschaut haben und (wie zum Beispiel Shortmail) nur Kurz-eMails zulassen. Denn auch die Leser freuen sich, wenn die Nachrichten und Informations-Fetzen nur kurz ausfallen – dann ist auch die Bereitschaft größer, sich überhaupt auf den Austausch einzulassen. Last but noch least ist der Dialog nicht mehr nur auf einen Sender und seinen Empfänger beschränkt, sondern findet zwischen ganze Gruppen, die nun interagieren können. Und man kann sich durch entsprechende Filter seinen ganz persönlichen Nachrichten-Stream aus verschiedenen Quellen zusammenstellen.
Die Informationen, die man hier bekommt, sind zudem auch noch deutlich innovativer als auf traditionellem Weg: Der amerikanische Soziologe Marc Granovetter hat bereits 1973 die Theorie von der Stärke schwacher Bindungen aufgestellt: Weil starke Bindungen zu Leuten, die man gut kennt wie Freunden, Familie oder Arbeitskollegen oft untereinander sehr ähnlich sind, weil man den selben Bekanntenkreis hat, bekommt man über diese starken Bindungen nur wenig neue Informationen. Schwache, oberflächlichen Bindungen, wie sie in sozialen Netzwerken üblich sind, bieten daher ein viel höheres Potenzial für Innovationen, weil auf diesem Wege ganz neue Impulse und andere Sichtweise zu einem gelangen, nach denen man vermutlich nicht einmal gefragt hätte, weil man nicht darauf gekommen wäre.
Marktplatz im globalen Dorf
Der kanadische Philosoph und Kommunikationsrhetoriker Marshall McLuhan, der als Begründer der Medientheorie gilt, hatte viele Veränderungen durch das Internet bereits früh vorausgesehen und viele auch heute noch gängige Begriffe geprägt: etwa die 15 Minuten Ruhm, die viele im Internet suchen, das Surfen im Meer der Information und das Medium als die Botschaft. 1962 schrieb er in seinem Buch “Die Gutenberg-Galaxis” über das Globale Dorf, zu dem die Welt durch die elektronischen Medien werde. Waren die Menschen vor der Erfindung der Schrift auf die unmittelbare Kommunikation mit dem anderen Menschen durch Stimme und Ohr angewiesen und mussten daher in Hörweite, also in Dorf- und Stammesgemeinschaft, miteinander leben, änderte sich das mit der Erfindung der Schrift. Einerseits war von nun an Kommunikation auch über weitere Distanzen möglich, gleichzeitig mussten sich die Menschen beim Lesen die dazugehörigen Bilder nun vorstellen, weil sie sie nicht mehr direkt vor Augen hatten. Das zwang sie zur Konzentration, zu individueller Isolierung und zum kausalen, linearen Denken. Die Erfindung des Buchdrucks verstärkte diese Entwicklung noch, weil nun nicht mehr nur einige wenige, sondern die Mehrheit lesen konnte. Das machte die Industrialisierung erst möglich und förderte Nationalismus und Individualisierung – und damit die Entfremdung der Menschen voneinander. Eine einschneidende Veränderung, die mit den Umwälzungen durch das Internet heute vergleichbar ist.
Denn die elektronischen Medien ändern unsere Wahrnehmung und unser Denken erneut, weil sie wie eine Verlängerung unserer Sinnesorgane wirken: Dank Bild und Ton die Hör- und Sprechkommunikation der dörflichen Stammeskultur zurück, in der Individualität zugunsten einer kollektiven Identität aufgegeben wird. Ein globales Dorf entsteht: Ohne seinen Standort zu ändern kann man über das Internet mit Menschen aus aller Welt in Kontakt treten. Die Welt wächst durch die Vernetzung enger zusammen. Das kann aber nicht nur positive Folgen haben: McLuhan warnte auch vor Möglichkeiten des Missbrauchs, vor Totalitarismus und Terrorismus, wenn auf die Gefahren, die von den neuen Medien ausgehen, nicht angemessen reagiert würde. Und machte damit klar, dass Technologie keine Moral in sich hat: Sie ist nur ein Werkzeug, bei dem es immer darauf ankommt, wie der Mensch sie verwendet.
Heute ist das Globale Dorf bereits bevölkert – und zwar von den Digital Residents, die in der Definition von Peter Kruse im Netz zu Hause sind: Sie wollen möglichst unterschiedliche Quellen der Inspiration nutzen, schnell und unkompliziert interessante Kontakte knüpfen, sich austauschen und kreativ die Gesellschaft mitgestalten. Dazu treffen sie sich regelmäßig auf den Marktplätzen im Global Village. Digital Visitors hingegen haben genau mit diesen Kommunikationsformen Schwierigkeiten: Sie scheint ihnen zu oberflächlich, zu selbstdarstellerisch und überfordert sie. Den Digital Visitors sind hingegen der Schutz ihrer Privatsphäre, Präzise Informationen mit Tiefgang und vertraute, persönliche Beziehungen wichtiger. Wenn aber gemeinsame Wertvorstellungen vorhanden sind, so hat der Internet-Aktivist Stephan Urbach bei politischen Aktionen festgestellt, dann lassen sich sogar diese Gegensätze überwinden – zum Beispiel wenn man gemeinsam für eine gute Sache arbeitet und plötzlich den gleichen Wertmaßstab hat: “Ich teile die Aussage, dass Diskussionen zwischen Residents und Visitors von Konflikten geprägt ist. Aber wenn es um ein gemeinsames, erreichbares Ziel geht, verschwinden diese Grenzen und Gegensätze und man kann zusammen arbeiten. Und die Welt ein Stück besser machen.”
Märkte sind Gespräche
1999 veröffentlichen Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls und David Weinberger das Cluetrain Manifest. In 95 Thesen formulierten Sie eine neue Beziehung zwischen Menschen und Märkten in Zeiten des Internets. Die Kernaussage war, dass die Macht des konventionellen Marketing schwindet und dass das Internet das Ende der einseitigen Kommunikation bedeutet. Verkaufen, das bedeutet zukünftig nicht mehr, Kunden mit Werbebotschaften zu berieseln, sondern einen ständigen Dialog mit ihnen zu führen.
Denn Untersuchungen zeigen, dass reine Werbung häufig nicht beachtet wird. Das kennt jeder von sich selbst: In den Werbepausen beim Fernsehen geht man raus oder zappt herum und blinkende Banner im Internet klickt man genervt weg. Kaufen wird man das Produkt eher nicht. Wenn uns aber ein Freund erzählt, dieses oder jenes Produkt ist der absolute Hit – dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir es auch kaufen. Und auch wenn wir überlegen, etwas zu kaufen fragen wir gerne mal Freunde um Rat – einfach weil wir ihnen vertrauen. Genau auf diesem Prinzip basieren Erfolge von Unternehmen in Sozialen Netzwerken: Das Zauberwort heißt Empfehlungsmarketing. Das Ziel besteht darin, dass die eigenen Produkte oder Dienstleistungen von möglichst vielen Menschen in Sozialen Netzwerken empfohlen werden.
Im Idealfall funktioniert das so, wie Sachar Kriwoi es beschreibt: Über das Zuhören und Erkennen von Bedürfnissen. Ein Unternehmen, das Kunden einen guten Service und gute Produkte anbietet, wird weiter empfohlen. Es kann mit ehrlicher, guter Leistung wirklich überzeugen, ein postives Image aufbauen und so Kunden an sich binden. Und genau dafür ist Social-Media bestens geeignet, weil es den Empfehlungseffekt potenzieren kann. Umgekehrt werden schlechte Produkte, Fehler und mieser Service ebenso schnell publik und schaden dem Image eines Unternehmens nachhaltig. Der Transparenz und Offenheit im Netz sei Dank! Am Ende haben also diejenigen Unternehmen die Nase vorn, die gut zu ihren Kunden sind – klingt schön, oder?
Licht und Schatten der Kommunikation
Leider ist die Realität nicht ganz so ideal. Denn wo Licht ist, ist leider auch Schatten. Unternehmen, denen es vor allem um das Erfüllen von Kennzahlen und pure Gewinnmaximierung geht, haben mit dieser Struktur sozialer Netzwerke so ihre Probleme. Um ihre Ziele zu erreichen, wird in der Regel eine geschickte Strategie ausgetüftelt, die von A-Z durchgeplant ist. Dahinter steckt der Wunsch, das Ergebnis von Vornerein kontrollieren zu wollen, damit das Gewünschte auch ja wie geplant eintritt. Folgt man dem Psychologieprofessor Peter Kruse, müssen Unternehmen damit zwangsläufig scheitern. Denn eine Web-2.0-Strategie ist für ihn ein Widerspruch in sich, weil sie eine Steuerbarkeit impliziert, die es gar nicht gibt. Soziale Netzwerke aber verweigern sich diesem klassisch strategischen Denken, weil sie Selbstorganisation ausgelegt sind. Statt strategischem Kontrollzwang empfiehlt Kruse ganz einfach: Mitschwimmen. “Es geht darum, Teil einer unkontrollierbaren Dynamik zu sein. Und zu tun, was Unternehmer schon immer getan haben: Sie haben sich rezeptiv und einfühlsam in der Kultur bewegt, in der sie tätig waren. Sie sind intuitiv mitgeschwommen und haben dann auf der Basis gemachter Erfahrungen ihre Impulse gesetz.”
Wie schwer sich Unternehmen, bzw. deren Entscheider, damit tun, die Kontrolle abzugeben und sich sozusagen intuitiv dem Zufall zu überlassen, demonstrierte eindrucksvoll der bekannte Reinigungs-Mittel-Hersteller Henkel. Dort hatte man einen Wettbewerb ausgeschrieben, durch den man kreative Design Vorschläge für Spülmittelflaschen finden wollte. Doch die 50.000 eingereichten Entwürfe fielen kreativer aus als erwartet: Bratwürste, Brezelduft und vor allem der Entwurf mit Hähnchengeschmack des Werbetexters Peter Breuer fanden Angklang im Internet. Henkel griff daraufhin mehrfach manipulierend ein: Man gab nur noch ausgwählte Entwürfe für den Wettbewerb frei oder bereinigte die Rangliste. Grund: Das Spülmittel sollte eben am Ende nicht nur witzig und kreativ sein, sondern auch gekauft werden – und da war der Hähnchengeschmack schlicht der Marketin-Strategie im Wege.
Und da viele Unternehmen Social Media längst als Marketing-Kanal entdeckt haben, sind solche und ähnliche Manipulationen leider mittlerweile alles andere als unüblich: Zum Beispiel werden mit Tricks Follower- oder Click-Zahlen in die Höhe getrieben, Empfehlungen und Bewertungen geschönt oder ganze positive Blogartikel fingiert. Denn längst ist im Netz ein heftiger Konkurrenzkamp über die meisten Fans und die besten Bewerungen entbrannt. Und es gibt zahlreiche Unternehmen, die solche Dienstleistungen auch recht unverholen im Netz anbieten. Und auch für die User erscheint das auf den ersten Blick lohnenswert: Freunden Jobs und Produkte zu empfehlen, die man selbst gut findet und dafür noch Geld zu verdienen, kann doch nicht so schlimm sein. Leider doch, denn für ein paar Klicks verspielen diese User ihre wertvolle Reputation. Und genau daran zeigt sich auch die große Gefahr von Social Media: Wenn die Grenzen zwischen Kommunikation und Werbung immer mehr verwischen, weil letzte nicht klar als solche kenntlich gemacht wird, dann pervertiert das die Idee von Social Media grundlegend. Doch wie genau sehen die Gefahren aus, die von dieser falsch verstandenen Web 2.0-Kommunikation ausgehen? Und wie kann man dem vorbeugen bzw. entgehen?
Hier schreibt für Sie
 Simone Janson ist Verlegerin, Beraterin und eine der 10 wichtigsten deutschen Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index. Sie ist außerdem Leiterin des Instituts Berufebilder Yourweb, mit dem sie Geld für nachhaltige Projekte stiftet. Laut ZEIT gehört ihr als Marke eingetragenes Blog Best of HR – Berufebilder.de® zu den wichtigsten Blogs für Karriere, Berufs- und Arbeitswelt. Mehr zu ihr im Werdegang. Alle Texte von Simone Janson.
Simone Janson ist Verlegerin, Beraterin und eine der 10 wichtigsten deutschen Bloggerinnen laut Blogger-Relevanz-Index. Sie ist außerdem Leiterin des Instituts Berufebilder Yourweb, mit dem sie Geld für nachhaltige Projekte stiftet. Laut ZEIT gehört ihr als Marke eingetragenes Blog Best of HR – Berufebilder.de® zu den wichtigsten Blogs für Karriere, Berufs- und Arbeitswelt. Mehr zu ihr im Werdegang. Alle Texte von Simone Janson.







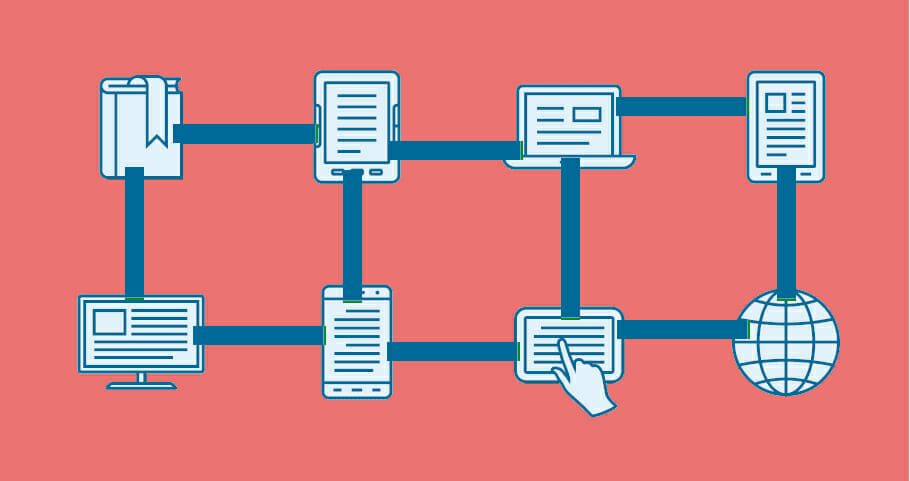
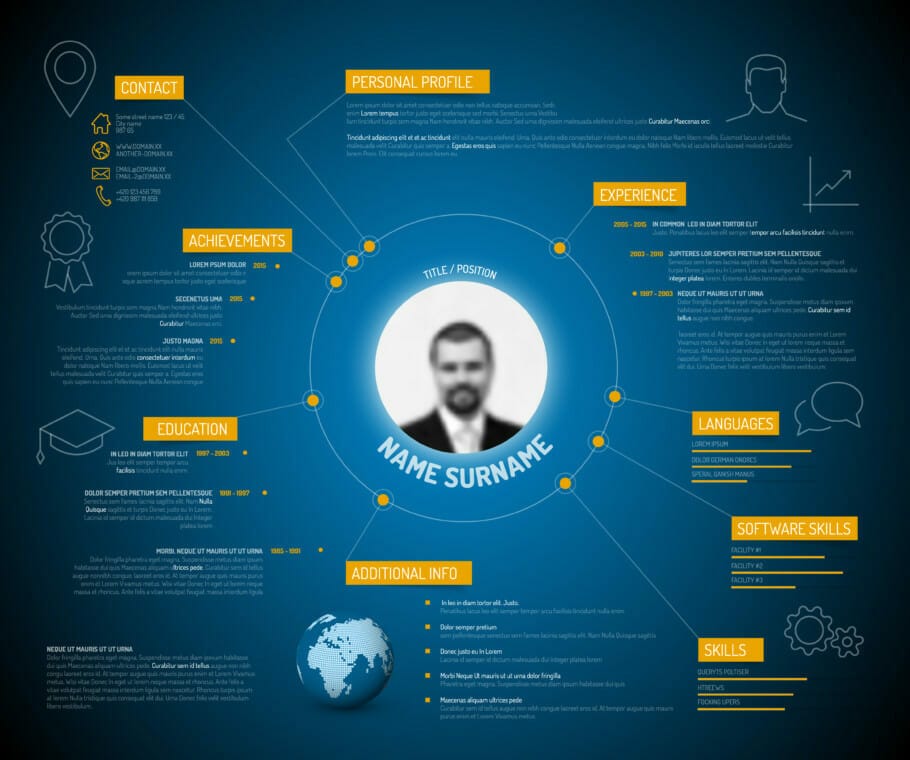
Schreiben Sie einen Kommentar